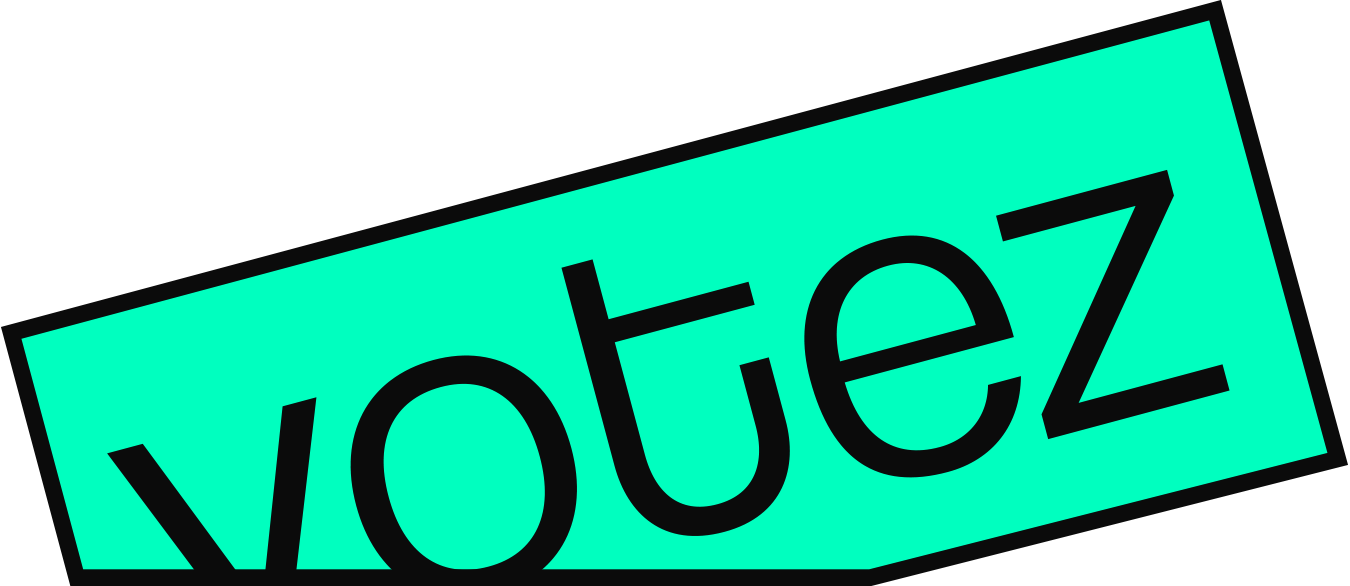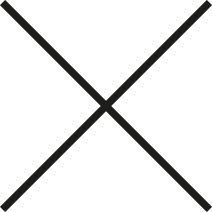Urnengang vom


1 Bundesbeschluss kantonale Liegenschaftssteuern (Abschaffung Eigenmietwert)
Die Schweiz kennt mit dem Eigenmietwert eine eigentümliche Steuer: Wer in der eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus wohnt, muss fiktive Mieteinnahmen versteuern. Dafür lassen sich grosszügig Hypothekarzinsen abziehen. Das Steuersystem bestraft selbstbewohnte Immobilien und belohnt Schulden. Beides soll abgeschafft werden, Hypothekarschuldenabzug gäbe es nur noch bei Erstkäufern. Derweil die Linke generell dagegen ist, dass der Eigenmietwert fällt, weil Steuereinnahmen fehlen würden, hadern auch konservative Bergkantone. Sie fürchten Steuerausfälle, weil der Eigenmietwert auch bei selbstgenutzten Ferienimmobilien wegfallen soll. Wobei die Bergkantone die Möglichkeit erhalten, andere Steuern auf Ferienimmobilien zu erheben. Generell führt die Vorlage zu Steuerausfällen in Zeiten tiefer Hypothekarsätze, derweil sie bei höheren Zinsen zu höheren Steuereinnahmen führt.
Nein sagt die Linke, Ja die Bürgerlichen, GLP Stimmfreigabe
Kommentar: Faire Steuern vs Steuerausfälle? Wirklich?

2 E-ID-Gesetz
Eine staatliche Digital-Identität erlaubt es, sich im Netz auszuweisen, sich mit dem Handy auszuweisen und erleichtert das Leben. Die Server betreibt der Bund, sie stehen in der Schweiz, die E-ID ist freiwillig und kostenlos. Sie trägt damit der Kritik der letzten Vorlage Rechnung, welche sie privat organisieren wollte. Deshalb stehen die meisten Gegner:innen der letzten Vorlage nun für ein Ja ein, auch wenn Fragen bleiben. Insbesondere: Unternehmen können Daten sammeln. Das Nein-Lager umfasst die SVP, Querulantenorganisationen und die Piratenpartei.

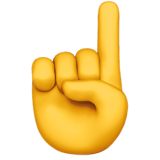
Kommentar: Faire Steuern vs. Steuerausfälle? Wirklich?
Die Debatte über die Eigenmietwert-Abschaffung ist eine ziemlich schräge, die am Wesentlichen vorbeigeht. Die Ja-Seite argumentiert mit “fairen Steuern”. Nun ist es tatsächlich eigentümlich, dass man bei selbstbewohntem Eigentum fiktive Mieteinnahmen besteuert. Also das, was man erhalten würde, wenn man das Wohneigentum vermieten würde. Bei anderen Anschaffungen ist das nicht der Fall. Kauft jemand statt einer Wohnung einen Ferrari, lässt sich der Wagen nutzen, ohne dass man die fiktiven Einnahmen versteuern müsste, die man erhielte, würde man ihn an andere leasen oder vermieten. Und auch wer sein Geld verjubelt, statt es in Eigentum anzulegen, ist besser dran. Geht man davon aus, dass Leute, die ihr Geld nicht vergeuden und stattdessen in den eigenen vier Wänden wohnen, zu denen gehören, die weniger schnell auf staatliche Hilfe angewiesen sind, dann setzt der Eigenmietwert einen falschen Anreiz. Feststellen lässt sich jedenfalls, dass die Schweiz im internationalen Vergleich eine tiefe Eigenheimquote hat. Das Modell, dass in vielen Ländern Rentnerinnen und Rentner über die Runden kommen, weil sie im abbezahlten Eigenheim leben, ist bei uns nicht vorgesehen. Zumal – im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern – ein Eigenheim auch noch im Rahmen der Vermögenssteuer besteuert wird. Aber ob die Steuer fair ist oder nicht, darüber lässt sich streiten, da Eigenheimbesitzer in der Regel eher wohlhabend sind. Ein gutes Pro-Argument ist Fairness deshalb nicht.
Was die Steuerausfälle anbelangt, so argumentiert die Nein-Seite äusserst salopp und in Teilen unredlich. Zu Steuerausfällen kommt es bei den tiefen Hypothekarsätzen, die zur Zeit gelten. Geschätzt zu 1,8 Milliarden. Steigen die Hypozinssätze, so sinken die Ausfälle. Ab 3% rechnet der Bund gar mit Mehreinnahmen.
Und damit zur staatspolitisch bedeutsamen Seite der Vorlage: Der Entschuldung der Haushalte. Heute gibt es in der Schweiz Hypothekarschulden in der Höhe von 1000 Milliarden. Steigen irgendwann die Zinsen wieder, so drohen heftige Verwerfungen. Die 90er-Jahre lassen grüssen! Dass unser Steuersystem das Schuldenmachen belohnt und befeuert, ist Nonsens. Und dass sich – gegen die geballten Interessen der Banken – eine parlamentarische Mehrheit fand, um das zu korrigieren, das ist der bedeutsame Teil der Vorlage. Und wichtiger als die Frage, ob es fair ist, wenn Leute, die in den eigenen vier Wänden wohnen, mehr oder weniger zahlen.


Initiative «Zämme in Europa»
Durch die Grenzlage ist Basel-Stadt besonders bewusst, wie wichtig gute Beziehungen zur EU sind. Die Initiative «Zämme in Europa» will den Kanton in der Verfassung verpflichten, «sich für gute und stabile Beziehungen der Schweiz mit der Europäischen Union und den Nachbarländern» einzusetzen. Sie hat vor allem symbolischen Charakter und will ein Zeichen gegen die Abschottung in die übrige Schweiz senden. Ausser der SVP sagen im europafreundlichen Basel alle Parteien Ja.


Volksinitiative für faire und bezahlbare Mieten
Die «Miet-Initiative» soll im Kanton Bern den Anstieg der Mietzinse dämpfen und ungerechtfertigte Mietzinserhöhungen sichtbar machen. Das Initiativkomitee aus Kreisen des kantonalbernischen Mieterinnen- und Mieterverbands, der SP, der Grünen und der EVP verlangt, dass beim Wohnungswechsel auf einem Formular der frühere Mietzins offengelegt wird. Und zwar dann, wenn im Kanton oder in einzelnen Verwaltungskreisen Wohnungsmangel herrscht, also höchstens 1,5 Prozent aller Wohnungen leer stehen.
Das Initiativkomitee rechnet vor, dass die Mieten im Kanton Bern in den letzten 20 Jahren um 30% angestiegen sind und ungebremst weitersteigen. Immobilienfirmen weisen darauf hin, dass trotz derzeit sinkendem Referenzzinssatz die Mieten der auf dem Markt verfügbaren Wohnungen Familienbudgets stark belasten.
Im Berner Kantonsparlament lehnt die bürgerliche Mehrheit die Initiative mit 84 gegen 66 Stimmen ab. Die Gegner verteidigen die Sicht der Hauseigentümerinnen, obwohl im Kanton Bern gut 62 % der Wohnungen vermietet sind. Die bürgerliche Seite findet, die Initiative bringe bloss neue Bürokratie mit sich. Überdies habe die Offenlegung der Vormiete keinen Einfluss auf die Mieten. In den acht Kantonen, die das Instrument anwenden, sind die Mieten allerdings um 2 Prozent weniger stark gestiegen als in Kantonen ohne Meldepflicht.


Verpflichtungskredit für Leistungsvertrag mit der Vereinigung Berner Gemeinwesenarbeit VGB
Die Stimmberechtigten entscheiden über einen auf 14,9 Millionen Franken erhöhten Kredit, mit dem in der Periode 2026 bis 2029 die Dachorganisation der Stadtberner Quartierarbeit und Nachbarschaftshilfe unterstützt werden soll. Das Stadtparlament stimmt dem unbestrittenen Geschäft grossmehrheitlich und mit wenigen Gegenstimmen zu.


Energiegestz
Kanton und Gemeinden sollen auf Gesetzesstufe angehalten werden, klimafreundliche Investitionen zu tätigen und ihre Gebäude entsprechend zu sanieren. Bis 2040 sollen die Treibhausgasemissionen auf Nettonull sinken. Ja sagen Linke und GLP. SVP, FDP und Mitte argumentieren, dass zu viel Kosten entstünden, außerdem sei das Ziel 2040 nicht umsetzbar. Wer findet es müsse beim Klimaschutz energisch vorwärts gemacht werden, stimmt Ja. Nein sagt, wer eine stärkere Belastung und mehr Regeln fürchtet.


1 Volksinitaitive «VBZ-Abo für 365 Franken»
Ein Jahresabo der VBZ soll 365 Franken kosten, für Kinder und Jugendliche 185 Franken , um den öffentlichen Verkehr zu fördern. Zürich habe genug Geld, und in anderen europäischen Städten sei der öV gratis. Der Stadtrat ist dagegen, er möchte nur Ärmeren das Billet verbilligen. Ja sagen SP und Grüne, Nein die Bürgerlichen und die GLP, die AL enthält sich.
- Ja-Komitee
- Pro et Contra der AL
- TagesAnzeiger: Kritische Stimmen im Gemeinderat

2 Parkkartenverodnung
Neu sollen nur noch Autohalterinnen eine Karte für die blaue Zone erhalten, wenn sie privat oder bei der Arbeit keinen Parkplatz nutzen können. Der Preis für die blaue Zone bemisst sich neu nach dem Leergewicht, wobei Elektrofahrzeuge 35 Rappen pro Kilo, Benziner 40 Rappen pro Kilo zahlen, womit dem Trend zu schweren SUVs entgegengewirkt wird. Für Gewerbe und Servicebetriebe gibt es gute Möglichkeiten. Die bürgerliche Gegnerschaft argumentiert, dass Parken teurer wird und dass mit dem Kilopreis “schwere Familienfahrzeuge» höher belastet werden.

3 Einsatzbeschränkung Laubbläser
Wegen des Lärms und des Feinstaubs sollen mit Benzin betriebene Laubbläser verboten werden, elektrische nur von Oktober bis Dezember erlaubt sein. Ja sagen Linke und GLP. Dagegen sind die Bürgerlichen besonders wegen des generellen Verbots von Januar bis September.

4 Ersatzneubau Sportzentrum Oerlikon (373 Millionen)
Das Hallenbad ist 50 Jahre alt, die Eisbahn 40, sie sollen durch eine neue Anlage ersetzt werden. Dagegen sind nur die Grünen, die finden, das Projekt sei zu wenig ökologisch, insbesondere weil man abreisst, statt zu erhalten. Ein stichhaltiges Nein-Argument sind die Kosten.
- NZZ zu den Kosten

5 Ersatzneubau Haus A (92 Millionen)
Das Hallenbad ist 50 Jahre alt, die Eisbahn 40, sie sollen durch eine neue Anlage ersetzt werden. Dagegen sind nur die Grünen, die finden, das Projekt sei zu wenig ökologisch, insbesondere weil man abreisst, statt zu erhalten. Ein stichhaltiges Nein-Argument sind die Kosten.
- NZZ zu den Kosten

JA 6 Sportanlage Juchhof (26 Millionen)
Ein Garderobengebäude wird ersetzt. Die Vorlage ist unbestritten.