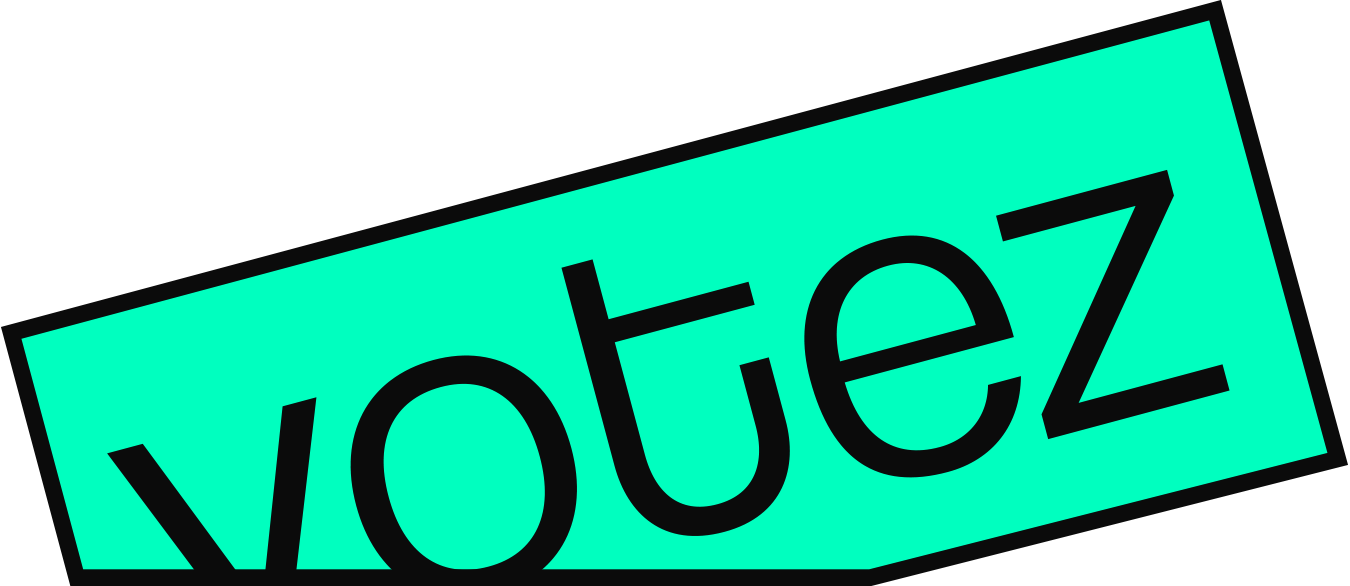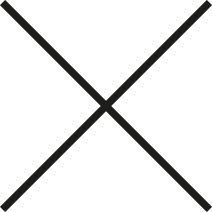Urnengang vom


1 OECD / Mindestbesteuerung
140 Länder haben sich auf eine Mindeststeuer von 15% auf Gewinne von Grossunternehmen (mind. 750 Mio Umsatz) verständigt. Hierzulande sind sich die Parteien einig, dass die Schweiz mitzieht. Linke und Hilfswerke kritisieren aber, dass von den Mehreinnahmen in Höhe von eins bis 2,5 Milliarden bloss ein Viertel an den Bund geht. Derweil der allergrösste Teil von den Kantonen Zug und Basel-Stadt einkassiert würde.
Ja sagen Bürgerliche und Wirtschaftsverbände, Nein die Linke und die Hilfswerke.

2 Klima- und Innovationsgesetz
Der Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative schreibt fest: Bis 2050 soll die Schweiz möglichst kein CO2 mehr ausstossen. Dafür gibt es Subventionen für Wärmepumpen, für innovative Unternehmen, derweil weder Verbote noch Steuern vorgesehen sind. Trotzdem hat die SVP das Referendum ergriffen, weil sie an Öl, Gas und Egoismus festhalten will. Wobei eines ihrer Argumente trifft: Soll die Schweiz auf elektrische Energie umschwenken, braucht es massiv mehr Stromproduktion, was bislang niemand richtig anpackt, und grüne Bremser berhindern. Ausser der SVP sind alle Parteien für ein Ja.

3 Covidgesetz
Das Covid-Gesetz, das schon zwei Mal angenommen wurde, ist stets befristet. Nun sollen einzelne Massnahmemöglichkeiten bis 2024 verlängert werden, so dass rasch gehandelt werden könnte, sollte sich eine neue gefährliche Virusvariante verbreiten. Der Bund könnte etwa noch nicht zugelassene Medikamente importieren. Oder die Einreise in die Schweiz regeln. Dagegen haben die üblichen Querulanten das Referendum ergriffen. Unterstützt werden sie lediglich von der SVP, alle anderen Parteien stehen für ein Ja.


Änderung der Kantonsverfassung: Anpassungen bei den Schuldenbremsen
Die meisten Parteien im Kantonsparlament möchten lockerere «Schuldenbremsen»-Vorschriften für Investitionen: Wenn der Kanton in den Vorjahren Überschüsse auswies, sollen diese bei künftigen Investitionen angerechnet werden dürfen. Diese mehrjährige Betrachtung brächte mehr Flexibilität. Gegen die nötige Verfassungsänderung stellen sich nur FDP und EDU: Sie sehen keinen Handlungsbedarf.

Volksinitiative "Für eine kantonale Elternzeit"
Die SP-Initiative verlangt einen 24-wöchigen bezahlten Elternschaftsurlaub – davon je sechs Wochen für Mutter und Vater, zwölf Wochen wären frei aufteilbar. Diese Elternzeit wäre ein kantonaler Zusatz zu den schweizweit gewährten 14 Wochen Mutterschafts- bzw. Vaterschaftsurlaub. Ein solcher Alleingang wird von allen bürgerlichen Parteien bis hin zur GLP abgelehnt: Mit jährlich 200 Millionen Franken sei er für die Kantonskasse zu teuer. Auch würden zusätzliche Absenzen die Unternehmen belasten. Die SP, unterstützt von den Grünen, argumentiert umgekehrt: Mit der Initiative würden Familie und Beruf besser vereinbar, was dem Fachkräftemangel entgegenwirkt. Ganz abgesehen davon, dass mehr Elternurlaub die Eltern-Kind-Beziehung stärke.


Anstellungsbedingungen der Stadt: Teilrevision des Personalreglements
Das revidierte Reglement will bessere Bedingungen für das städtische Personal schaffen. So würde etwa die Teuerung jährlich zwingend ausgeglichen, und es gäbe zusätzliche bezahlte Urlaube bei Elternschaft.
Die bürgerlichen Parteien haben dagegen das Referendum ergriffen: Die Anstellungsbedingungen seien schon heute gut; eine weitere Privilegierung könne sich Bern nicht leisten. Gemäss der links-grünen Mehrheit im Stadtparlament hingegen braucht es das soziale fortschrittliche Reglement, um auch künftig genügend Fachkräfte für den Service public zu finden.

Parkkartengebühren: Teilrevision des Gebührenreglements
In einer Zone mit Parkscheibenpflicht parkieren Anwohnende bisher für 264 Franken pro Jahr. Das Stadtparlament möchte die Gebühr auf 492 Franken erhöhen (oder 384 Franken für Elektroautos). Dagegen hat ein bürgerliches Komitee das Referendum ergriffen: Die Verteuerung um satte 86 Prozent sei überzogen, unsozial und komme einer verkappten neuen Steuer gleich. Die links-grüne Parlamentsmehrheit entgegnet, die heutige Parkkartengebühr sei nicht kostendeckend. Ihre Erhöhung fördere ausserdem das Umsteigen auf öffentlichen Verkehr oder Velo – dies im Einklang mit den Klimazielen des Stadt.

Betriebsbeiträge an vier Kulturinstitutionen für die Jahre 2024 bis 2027: Verpflichtungskredite
Die Stadt Bern fördert vielfältige Kultur mit der Subventionierung zahlreicher Institutionen. Bei vier von ihnen sind die Betriebsbeiträge hoch genug, dass das Stimmvolk das letzte Wort erhält. Dies betrifft das Bernische Historische Museum (1,7 Millionen Franken pro Jahr), Bühnen Bern (18,4 Mio), die Kornhausbibliotheken (3,4 Mio) sowie die Dampfzentrale (2,4 Mio). Aus Spargründen sind diese Beträge teilweise geringer ausgefallen als in der Vergangenheit.
Es wird über die verschiedenen Kulturinstitutionen separat abgestimmt.
Im Stadtparlament erfuhren alle vier Vorlagen parteiübergreifend praktisch einhellige Zustimmung.

Viererfeld/Mittelfeld: Abgabe von zwei Landflächen im Baurecht
Auf dem Viererfeld und dem Mittelfeld sollen über 1100 neue Wohnungen entstehen. Darüber wurde schon mehrfach abgestimmt – nun geht es noch um die Abgabe des stadteigenen Landes im Baurecht (eine Art Vermietung des Bodens).
Eine der Baurechtsnehmerinnen ist die Hauptstadtgenossenschaft Bern. Sie wird Wohnungen in preiswerter Kostenmiete erstellen, weshalb sie beim Baurechtszins günstigere Konditionen erhält. Dies gilt nicht für die Mobiliar Asset Management AG, eine Investorin für den rein marktorientierten Wohnungsbau. Über die beiden Baurechtsvorlagen wird separat abgestimmt.
Die Überbauung von Vierer- und Mittelfeld hat in der Vergangenheit grundsätzliche Opposition geweckt: Einige links-grüne Kreise wie auch SVP-Leute möchten die Fläche als «grüne Lunge» erhalten.
Die Berner Parteien von links bis rechts stehen jedoch mehrheitlich hinter dem Projekt. Es sei besser, dem akuten Wohnungsmangel an so gut erschlossener und zentraler Lage zu begegnen, als irgendwo draussen auf dem Land zu bauen.

Genereller Entwässerungsplan: Rahmenkredit für mittelfristige Massnahmen
300 Kilometer Kanalisationsrohre und zahlreiche zugehörige Einrichtungen besorgen den korrekten Abfluss des Wassers in der Stadt. Wie die Entwässerungsplanung zeigt, sind etliche Abwasseranlagen mangelhaft oder reparaturbedürftig. Für die nötigen Massnahmen braucht es über die nächsten zehn Jahre rund 110 Millionen Franken. Dies nicht aus Steuermitteln, sondern aus den gesammelten Abwassergebühren der «Sonderrechnung Stadtentwässerung».
Das Stadtparlament hat das Vorhaben ohne Gegenstimme gutgeheissen.

Sanierung Kornhausbrücke: Verpflichtungskredit
Die Kornhausbrücke aus dem Jahr 1898 zeigt heute unter anderem Schäden an Fahrbahn und Abdichtung. Sie soll im Jahr 2025 saniert werden. Zeitgleich sollen die Tramgeleise ersetzt werden, wofür Bernmobil aufkommen wird.
Der Kostenanteil der Stadt beträgt 9,7 Millionen Franken; das Stadtparlament hat dem Kredit einstimmig zugestimmt.

Aufwertung des Strassenraums im Zuge des Ausbaus des Fernwärmenetzes: Rahmenkredit
Bis 2035 erweitert Energie Wasser Bern das Fernwärmenetz ab Energiezentrale Forsthaus auf rund 50 Leitungskilometer. Dabei müssen viele Strassen aufgebrochen werden. Die Stadt möchte davon profitieren und diese Strassen bei der Gelegenheit aufwerten: Stichworte sind Bepflanzungen, Entsiegelung, mehr Verickerungsflächen für ein besseres Stadtklima und mehr Aufenthaltsqualität; auch sollen etwa leisere Fahrbahnbeläge eingebaut werden und mancherorts ein sichererer Schulweg entstehen.
Solche Massnahmen sollen in den nächsten Jahren insgesamt rund 48 Millionen Franken kosten. Im Stadtparlament fand die Vorlage ungeteilte Zustimmung.


1 Gegenvorschlag zur Initiative «Ein Lohn zum Leben»
Auf dem Gebiet der Gemeinde Zürich soll ein Mindestlohn von 23.90 pro Stunde gelten, der künftig der Teuerung angepasst würde. Das entlaste den Sozialstaat, denn wer voll arbeitet, soll davon in der Stadt leben können. FDP, SVP und GLP haben das Referendum ergriffen: Sie fürchten Bürokratie und dass Jobs einfach in die umliegenden Gemeinden verschoben würden. Mitte und die Linke sagen Ja und verweisen auf Kantone wie Basel-Stadt oder Genf, die heute schon einen Mindestlohn haben.

2 Wohnraumfonds 100 & 200 Millionen / 3 Wohnraumfonds Änderung der Gemeindeordnung
Um einen Drittel preisgünstige Wohnungen zu ermöglichen, will die Stadt selber Wohnungen kaufen oder bauen, Genossenschaften unter die Arme greifen und Wohnungen subventionieren. Mitte und EVP kritisieren, dass schon wieder ein neues Instrument geschaffen wird, statt alles Bestehende zusammenzulegen. FDP und SVP stört, dass oft auch Leute profitieren, die keine verbilligten Wohnungen brauchen. Ja sagen die Linke und die GLP.

4 PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich, jährliche Beiträge von 10,6 Millionen
Die Pestalozzi-Bibliotheken sind über die ganze Stadt verteilt und leisten wertvolle Arbeit. Bislang winkte der Gemeinderat die 10 Millionen der Stadt durch, jetzt braucht es einmalig ein Volks-Ja. Die Vorlage ist unbestritten.

5 Ersatzneubau Schulanlage Saatlen für 231 Millionen
In Schwamendingen wächst die Bevölkerung massiv, deshalb braucht es ein neues Schulhaus. Die Vorlage ist unbestritten.

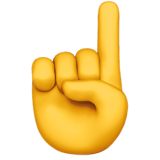
Kommentar: Mieten werden nicht sinken
Auch wir trommelten für ein Ja, als es darum ging, dass ein Drittel der Wohnungen kostengünstig sein sollte. Wir trommelten in der Hoffnung, dass die Stadt sehr viel mehr gemeinnützigen Wohnraum erstellen würde. In der Hoffnung, dass Zürich ein wenig mehr wie Wien würde, wo man die Gemeinde, Genossenschaften und Private bauen lässt, um der Wohnungsknappheit zu begegnen. Denn evident ist: Steigt die Bevölkerungszahl, ohne dass die Wohnraumproduktion Schritt hält, dann steigen auch die Mieten. Deshalb ist es Nonsens, einfach einzelnen Teilen der Bevölkerung die Wohnungen zu subventionieren. Kreuzfalsch ist es, wenn mit Verweis aufs Drittelsziel gewinnorientierter Wohnungsbau verhindert wird. Zürich braucht alles: Genossenschaften, städtischen Wohnungsbau und privaten.
Die Stadt begründet Zürichs hohe Mieten – nebst der hohen Nachfrage – mit «dem begrenzten Boden und den begrenzten Anlagemöglichkeiten.» Auch das ist Nonsens. Dass nicht mehr gebaut werden kann, liegt nicht am knappen Boden, sondern an der künstlichen Verknappung durch Instrumente wie der BZO, die Aufstockungen und energische Verdichtung verhindert.
Und damit führt die städtische Politik zu genau dem, was ihr die Gegnerschaft vorwirft: Zur Umverteilung für weniger Glückliche, anstatt dass der Nachfrageüberhang von der Produktionsseite angegangen würde. 300 Millionen zur Erstellung von mehr gemeinnützigem neuen Wohnraum im Rahmen von energischer Verdichtung und Neubauten wären eine gute Sache. Reine Umverteilung im Rahmen des bestehenden Wohnraums, als Mittel, um der Explosion der Mieten zu begegnen, ist kein taugliches Mittel.