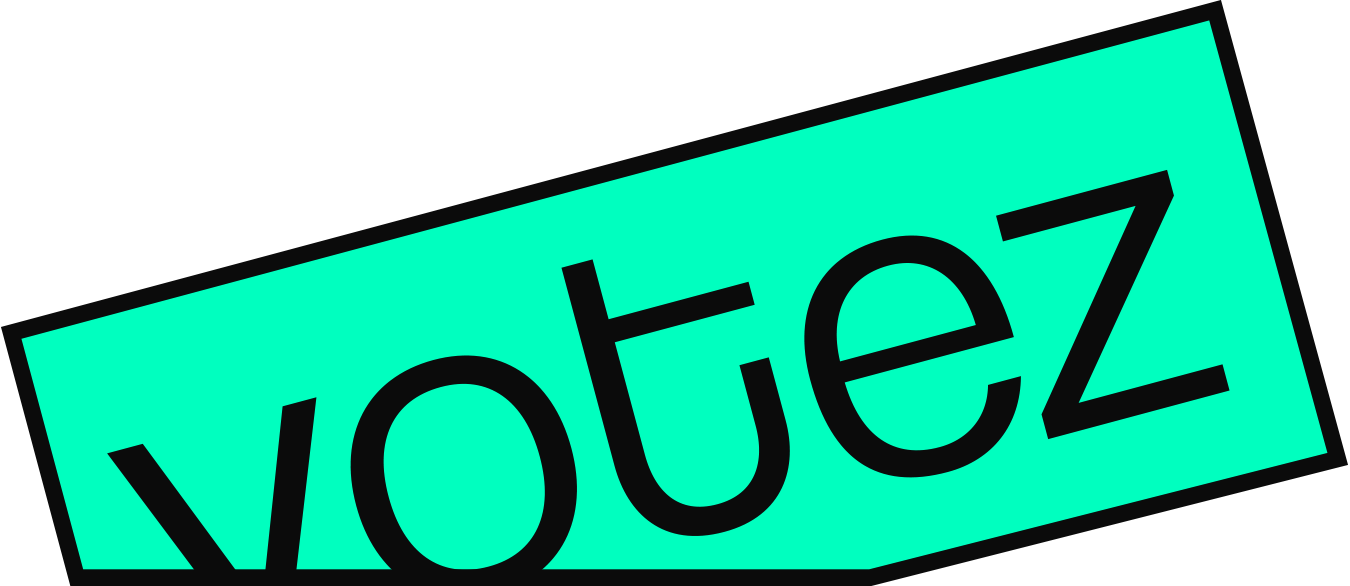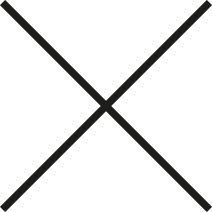Seit über 20 Jahren texten wir votez.ch und verfolgen entsprechend eng mit, was in der Schweiz über Politik berichtet wird. Schon öfters habene wir uns hier beklagt, dass es zwar mehr Stimmen im öffentlichen Konzert gibt, es für uns aber immer schwieriger wird, die nötigen Infos zusammenzutragen. Selbst in der Medienhochburg Zürich ist die seriöse Berichterstattung über städtische sowie kantonale Geschäfte im Laufe der Jahre immer dünner geworden. SRF, das dafür bezahlt würde, hat die Lücke nie gefüllt, sei’s aus Mangel an Fantasie, sei’s aus Angst vor Quotenversagertum.
Klar ist: Die Vorlage wird das nicht beheben. Sie wird höchstens mithelfen, dass sich das Problem nicht verschlimmert. Und richtig liegen alle, die sagen, die Vorlage sei ein Unding. Aus drei Gründen: 1. Es widerspricht jeder ökonomischen Vernunft, dass man heute noch die Zustellung von Druckerzeugnissen unterstützt, obwohl völlig klar ist, dass es sich dabei um ein Auslaufmodell handelt. 2. Richtig ist auch, dass finanzstarke Grossverlage keine Steuergelder brauchen. Dass ein Geizhals wie Pietro Supino, Boss von Txmedia, der seine JournalistInnen knechtet und auspresst, derweil seine Familie munter Dividenden kassiert, Geld erhalten soll, ist skandalös. (Details zu Txmedia und zu Supinos Geschäftsgebaren erläutert bswp. der Dokumentarfilm “Die vierte Gewalt” von Dieter Fahrer oder diese Republik-Serie.) 3. Stossend ist sodann, dass ein Medium wie watson nichts erhalten soll, obwohl das Portal gratis und franko viel für die Vermittlung der politischen Schweiz leistet. Das Gleiche gilt etwa für die Seite blick.ch, die neben Boulevard täglich seriösen Politikjournalismus bietet. Wie wenig man in der Kommission, die die Vorlage erarbeitete, vom digitalen Zeitalter versteht, belegte die Aussage, man habe Online-Gratismedien ausgenommen, weil die Gratiskultur falsch sei und man ein Bewusstsein schaffen wolle, dass Journalismus koste. Wer heute noch meint, hätte man nur früh genug Paywalls raufgezogen (Stichwort “Erziehung”), wäre das Internet heute ganz anders, hat keinen Schimmer von digitalen Business-Modellen. Und die Gratisportale leisten genau das, was die Vorlage will: Politische Berichterstattung. Nau z.B. berichtet immer wieder von Medienkonferenzen,die SRF einfach links liegen lässt.
Diese drei Punkte sprechen gegen die Vorlage. Warum also plädieren wir – zähneknirschend – trotzdem für ein Ja? Die Kurzfassung: Weil wir uns sicher sind, ohne diese Vorlage wird die mediale Lage noch düsterer. Und weil wir uns 100 Prozent sicher sind, eine bessere kommt nicht so bald nach. Ohne dass man Supino Geld zuschanzt, der ja nicht nur Twixgroup-Boss, sondern auch Chef des Verlegerverbandes ist, hätte man die wirklich wichtigen Online-Sachen kaum durch gebracht. Es ist wie oft in der Schweizer Politik, Vorlagen zimmert man nur, wenn man dabei auch Unsinniges mitfinanziert.
Nun zum Hauptargument der GegnerInnen: Medien würden handzahm, erhielten sie Geld. Das Gegenteil ist der Fall. Politik und ParlamentarIerInnen legen sich auffällig selten mit den Medien an, weil sie auf sie angewiesen sind. Was umgekehrt nicht gilt. Und: Würde das Argument stimmen, so müssten Produkte wie die NZZ, die Weltwoche oder die WoZ, die schon heute ordentlich Staatsgelder kassieren, unkritisch sein. Betrachtet man noch eine weitere Branche, deren Daseinsgrund in erster Linie üppige Subventionen sind, nämlich das Bauerntum, so hat man auch da nicht den Eindruck, es würde gekuscht, bloss weil es Jahr für Jahr Milliarden regnet. Das Abhängigkeitsargument ist lächerlich.
Und damit zu den Punkten, die für die Vorlage sprechen. 1. Sieht man sich die Gegnerschaft an, die von der Guggenmusig der Coronaspinner, den Freiheitstreichlern, über Medienmillionäre mit Geschäftsinteressen bis zu Blochermedien à la Weltwoche & Nebelspalter reicht, so hilft einem das, die Fronten zu klären. Und das spricht für ein Ja. 2. Dass das Mediensystem in der Bredouille ist, bestreitet niemand. Werbeeinnahmen landen bei Goolge, bei Facebook, bei Youtube, aber kaum bei den Lokalmedien, die über Gemeindeversammlungen und Lokalgeschäfte berichten. Das Anliegen ist also gut ausgewiesen. 3) Die Pandemie führt einem gut vor die Augen, wie wichtig halbwegs seriöse Information ist. Allerorten gehen verbiesterte Menschen auf die Strasse, die glauben, die Impfung enthalte Kontroll-Chips. Oder Geimpfte würden negative Energien abgeben. So manche glaubt heute, die Erde sei eine Scheibe, und so macher, wir würden von Echsen regiert. (Bzw. hier tippe eine auf ihrer gigantischen Echsenpoftentastatur.) Autoritäre Staaten wir Russland haben grosse Strukturen aufgebaut, die den lieben langen Tag Verschwörungen und Märchen verbreiten. Oder: Beispiel USA. In einer der ältesten Demokratien glaubt ein wesentlicher Teil, die letzten Wahlen seien gefälscht gewesen. Und das hat viel damit zu tun, dass das Mediensystem der USA am Schwinden ist. Der Druck auf offene und demokratische Gesellschaften ist massiv. Und Mehrheiten können rasch kippen, besonders, wenn es kein Mediensystem als Kontrollinstanz mehr gibt. Auch deshalb braucht es ein Ja.
Seit den 80ern gibt es Kreise, die auch hierzulande das Modell eines schrankenlosen Kapitalismus propagieren. Realpolitisch mit wenig Erfolg, aber man staunt doch wie sich die Diskurse verschoben haben und wie viele Armleuchter Liberalismus mit plumper Staatsfeindschaft verwechseln. (Meist, weil sie in Sachen Liberalismus nur gerade von Hayer kennen, derweil ihnen Popper, Mill oder auch ein Dahrendorf unbekannt sind.) Dann schwadroniert es daher, die “liberale Perspektive” dies und das und überhaupt, sei alles, was das Gemeinwesen tue von Staates wegen und damit des Teufels. Staatliche Medienstützung ergo “Verzerrung”, “Frevel”, wenn nicht gar “Sündenfall”. Das ist Nonsens. Selbst wer sich auf den Liberalismus beruft, sollte sich jeweils fragen, was Problemlagen sind, und wie ihnen zu begegnen ist. Das kann – auch wenn man staatlicher Intervention gegenüber skeptisch ist – durchaus auch einmal ein staatliche Instrument sein. Bei der Frage, wer über unsere demokratischen Belange bis auf die untersten Ebenen berichten soll, gibt es bislang niemand, der erklären könnte, wie der Markt das vernünftig lösen könnte.
Politische Entscheidungen sind realpolitisch zu treffen. Schaut man sich die Lage der Schweiz mit ihrem klitzekleinen Medienmarkt an (anderswo wären wir zahlenmässig ein Stadtteil), so ist klar: Unsere Demokratie hat ein Informationsproblem, das der Markt nicht lösen kann. In die Lücke springen Fanatiker wie Milliardär Blocher oder Tettamanti, die reich und getrieben genug sind, dass sie ihre Schatullen öffnen, damit Medien das schreiben, was die Herren gerne dem Volk zum Lesen geben. Wobei sie das gerne im Dunklen lassen. Blocher log, als es darum ging, wer die Basler Zeitung gekauft hatte. Bis heute ist undurchsichtig, wie die linksliberale Weltwoche zu Köppels nationalkonservativem Kampfblatt wurde. Das gleich gilt für Blocherlautsprecher Markus Somm, der sich mit unbekanntem Geld die älteste Satirezeitung der Schweiz krallen konnte und dort für die nationalkonservative Sache trommelt. Schon heute besitzt Blocher dazu ein Netz von Lokalzeitungen. Und stockkonservative Milliardäre, etwa der Partnersgroup EU-Gegner und Mormone Fredy Gantner oder sein Compagnon Urs Wietlisbach, der die Kampagne gegen das Covid19-Gesetz massgeblich finanzierte, haben sich noch nichts gekauft. Jedenfalls soweit man weiss. Aber mit ihrem Sendungsbewusstsein und dem vielen Geld, läge das auf der Hand.
Deshalb liegen auch Liberale falsch, die meinen, aus ideologischer Reinheit gegen die Vorlage sein zu müssen. Was dräut ist eine Medienlandschaft, die plötzlich vom Weltwochestil dominiert wird. Und da haben dann auch Liberale nicht mehr viel zu melden. Noch einmal sei der Blick in die USA empfohlen, wo allerorten Regionalmedien verschwunden sind. Dafür verteidigt Fox-TV bis in die hintersten Winkel Trumps Wahllügen oder – aktuell – Putins Anspruch, den UkrainerInnen sagen zu können, was sie zu tun haben. Und alle, die nicht auf Trumps Lügenlinie sind, werden gnadenlos abgestraft. Egal ob Demokraten oder Republikaner.
Fazit: Das sind die Gründe, warum wir trotz überflüssigen Subventionen für Zustellung, trotz Abzocker-Supino, trotz fehlender Unterstützung für Gratisportale überzeugt sind, dass es hier ein Ja braucht. Und zwar von allen, denn so wie die Umfragen aussehen, gewinnt das Nein, gewinnen die Köppels, die Blochers und die Freiheitstrychler.