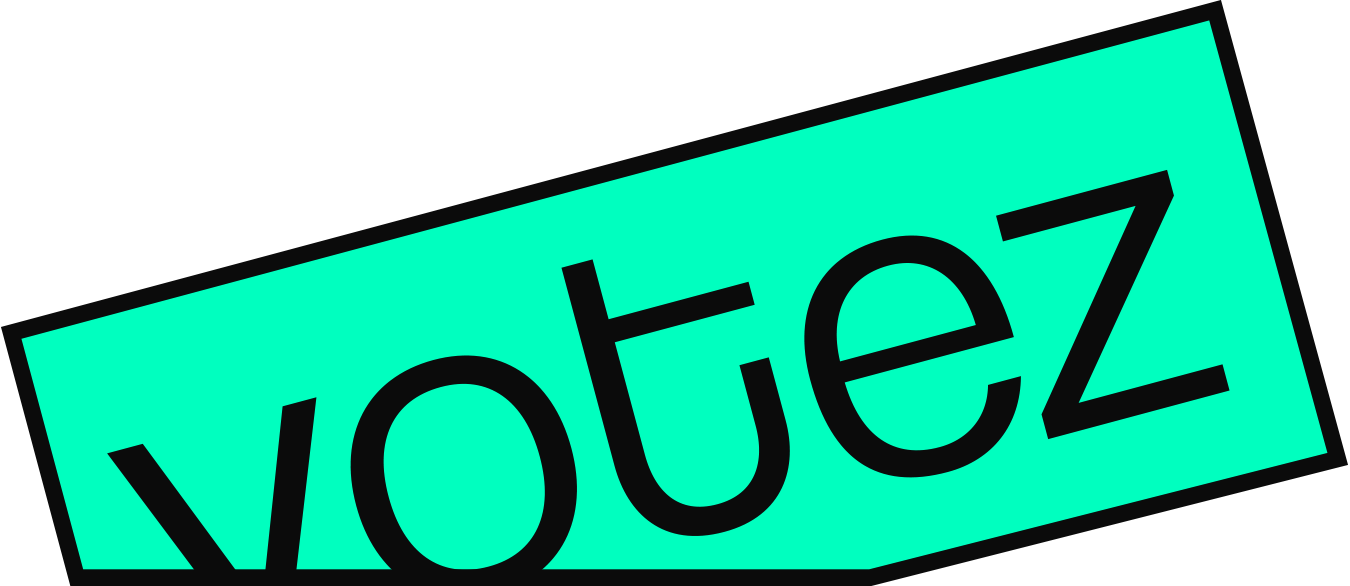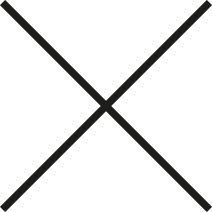Zwei Vorlagen stehen an. Erstens der Eigenbedarf. Wer eine Wohnung oder ein Wohnhaus besitzt oder kauft, kann heute oft nur mit viel Mühe und langwierigen Verfahren selbst dort einziehen, weil die Mieterschaft viele juristische Mittel hat. Das kann man gerecht finden oder nicht. Und es lassen sich für beide Perspektiven emotionalisierende Beispiele finden: Mieterinnen, die aus ihrem Umfeld gerissen werden und nichts mehr finden, weil sie wegen Eigenbedarf rausgedrängt werden. Oder Familien, die mit viel Anstrengung eine Wohnung erstehen, aber Jahre lang nicht einziehen können, weil ein Mieter alle Mittel ausschöpft.
Die Linke sagt, die Vereinfachung der Verfahren sei ein grossangelegter Angriff der mächtigen Immobilienlobby, um mehr Profite zu scheffeln. Das ist Unsinn. Beim Eigenbedarf geht es einzig um private Besitzerinnen, die eine Immobilie selbst bewohnen wollen. Immogesellschaften können keinen Eigenbedarf geltend machen.
Die Vorlage zur Untermiete, zweitens, sieht vor, dass Mieter neu eine schriftliche Bewilligung ihrer Vermieterin brauchen, wenn sie untervermieten wollen. Die Bewilligung müsste alle zwei Jahre erneuert werden. Scheinheilig behauptet der Hauseigentümerverband (HEV), damit wolle man Auswüchse bei Airbnb und überhöhte Untermieten verhindern. Auch das ist kompletter Unsinn. Wenn es darum geht, dass Recht von Immobilienbesitzenden auf Airbnb-Nutzung einzuschränken, hält der HEV jeweils dagegen. Und noch nie hat man gehört, dass der HEV, der vor allem ein SVP-Kampfvehikel ist, sich darüber grämt, dass jemand zu viel Miete zahlt.
Die Linke argumentiert generell, es ginge bei den beiden Vorlagen bloss darum, Mieterinnen rauszuwerfen, um die Mieten zu erhöhen. Das verweist auf das zugrundeliegende Problem: Die Preisdifferenz zwischen Alt- und Neumieten ist inzwischen so hoch, dass Wechsel der Mieterschaft für Vermietende oft attraktiv sind. Und Mietende, die suchen, finden nichts Vergleichbares. Das wiederum ist die Folge davon, dass die Bevölkerung in der Schweiz und vor allem in den Zentren zunimmt, derweil viel zu wenig Wohnraum produziert wird. Ein Zusammenhang, der inzwischen auch linken Ökonomen dämmert.
Ein Laboratorium zum Problem von Nachfrage und Wohnproduktion sind die Gliedstaaten der USA, wo generell und grob gilt: Demokratische Staaten, die mehr Einsprachemöglichkeiten gegen Neubauten und mehr Regulierungen haben, schneiden bei Wohnpreisen und dem Problem der «Homeless» schlechter ab als republikanische Staaten, die baufreundlicher sind.
Denn langfristig schlägt sich eine grosse Differenz von Angebot und Nachfrage immer im Preis nieder. Oder aber es kommen andere Verteilmechanismen für zu knappe Güter ins Spiel wie Korruption, Vetternwirtschaft oder die Bevorzugung bestimmter Gruppen. Bei hoher Knappheit, das zeigen viele Beispiele, funktionieren Preisdeckel oder ähnliche Massnahmen auf Dauer nicht. Oder aber, sie verhindern, dass gebaut wird.
Dazu kommt erschwerend, dass es meist recht lange dauert, bis Änderungen politischer Stellschrauben oder die preisdämpfende Wirkung eines erhöhten Angebotes durchschlägt. Etwa, weil es aus buchhalterischen Gründen kurzfristig attraktiver sein kann, eine hochpreisige Immobile leerstehen zu lassen, als den Preis zu senken.
Das Paradebeispiel für eine Stadt, die recht gut funktioniert, ist Wien, wo Genossenschaften, Private und die Stadt seit jeher kräftig bauen. Das wurzelt im produktionsorientierten Marxismus der 30er Jahre, der mehr Wohnraum für die Arbeiterschaft anpeilte. Die Schweizer Linke dagegen glaubt, das Problem verursachten vor allem besonders gierige Immobilienfirmen, die in Schach zu halten seien. Deshalb haben unsere links regierten Städte und die Linke generell keinen Plan, wie man der Nachfrage von mehr Menschen nach Wohnungen mit passender Produktion im grossen Stil begegnen könnte.